
Adipotide – Forscher haben einen neuen Wirkstoff entwickelt, der weiße Fettzellen abtötet. Bild: © fotolia.de
Speckfalten sehen nur bei Babys zum Anbeißen niedlich aus. Bei erwachsenen Menschen erfreut sich eine allzu üppige Vorratshaltung in Form vom Hüftgold und Schnitzelfriedhof nur in den seltensten Fällen einer attraktiven Anziehungskraft. So sehen sich Leute, denen die Badezimmerwaage die gelbrote Karte zeigt, der schwierigen Aufgabe gegenübergestellt, ab sofort ordentlich abzuspecken. Dazu gibt es auch zahlreiche Methoden, die allerdings jeweils mehr oder weniger darauf hinauslaufen, die Nahrungsaufnahme streng zu kontrollieren und zu drosseln. Deshalb träumen Viele im Angesicht ihrer recht übersichtlichen Mahlzeiten von einer Möglichkeit, das bestehende Übergewicht verlieren zu können, ohne deswegen darben oder hungern zu müssen. Und so mancher hat sich beim halbherzigen Biss in fettfrei angemachten grünen Salat schon sehnlichst eine Zauberspritze gewünscht, die den Speck auf den Rippen trotz üppiger Speisen ganz locker zum Verschwinden bringen könnte.
Nun scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Wissenschaft in dieser Hinsicht das Ei des Kolumbus gefunden hätte. Denn einem U.S. amerikanischen Forscherteam ist es geglückt, aufbauend auf Grundlagenforschungsbefunden der Stammzellentherapie ganz gezielt ausschließlich den unerwünschten weißen Fettzellen buchstäblich den Hahn abzudrehen, um sie anschließend auf Nimmer Wiedersehen ins biologische Nirwana zu schicken. Oder anders formuliert: Ab sofort könnte man dem gefährlichen weißen Fett mit einer ausgeklügelten Spritzenkur den ultimativ schlanken Todesstoß verpassen.
Adipotide gegen Fettzellen
Auch unter unseren Vettern, den Rhesusaffen, gibt es solche, die schön schlank sind, und solche, deren Bauch sich allzu stolz wölbt. An letzterer Gruppe erprobte die umfangreiche Forschergruppe um Dr. Kirstin F. Barnhart einen neuen Wirkstoff, den sie auf den Namen „Adipotide“ getauft hatte. Dieses Präparat als ein sehr konkretes Ergebnis aus der adulten Stammzellenforschung hat die einzigartige Eigenschaft, die gefährlichen und gefürchteten weißen Fettzellen aufzuspüren, und anschließend ganz gezielt so anzudocken, dass die Fettzellen komplett von der Blutversorgung wie auch von allen anderen biologischen Lieferanten abgeschnitten werden. Die solcherart vom Stoffwechselgeschehen restlos abgekoppelten Fettzellen müssen jetzt zwangläufig verhungern und zu Grunde gehen. Ihre sterblichen Überreste werden dann anschließend von den Putzkolonnen des Immunsystems ordnungsgemäß entsorgt, und sind ab dann nicht mehr gesehen. Auf diese sehr effiziente und vor allem sehr körperkonforme Art und Weise konnten die korpulenten Rhesusaffen in einem Monat gut 10 Prozent ihres Ausgangsgewichtes los werden, ohne deswegen auch nur auf eine einzige Banane verzichten zu müssen. Bei übergewichtigen Mäusen hat das zuvor übrigens ebenso perfekt geklappt.
Kann das denn auch beim Menschen funktionieren?
Mehr zum Thema Übergewicht und Fettzellen:
Daran haben die erfolgreichen Wissenschaftler keinerlei Zweifel. Denn beim Rhesusaffen, der genetisch sehr eng mit dem Menschen verwand ist, funktioniert das Zunehmen und Abspecken auf genau die gleiche Art wie beim Homo Sapiens. Außerdem ist das Abnehmwunder namens Adipotide eine völlig natürliche, ja, man könnte sogar sagen, körpereigene Substanz, die nichts anderes als ihren ganz normalen Job erledigt. Und der besteht nun mal darin, sich an einem sehr exklusiven Rezeptor, den es so nur für weiße Fettzellen gibt, anzukoppeln, und den Zufluss von Blut zu den Speckspeichern zu unterbinden.
Derzeit befinden sich Adipotide als Therapie gegen Übergewicht bereits in der klinischen Erprobung am Menschen. Der Tag, an dem Hungerkuren und Selbstkasteiungen im Namen der schlanken Linie Geschichte sein werden, rückt dementsprechend immer näher.
Weiterführender Link zum Thema:
Kirstin F. Barnhart und 16 weitere Autorinnen und Autoren: OBESITY – A Peptidomimetic Targeting White Fat Causes Weight Loss and Improved Insulin Resistance in Obese Monkeys. Science Translational Medicine 9 November 2011: Vol. 3, Issue 108, p. 108ra112 (Sci. Transl. Med. DOI: 10.1126/scitranslmed.3002621)
http://stm.sciencemag.org/content/3/108/108ra112.abstract?sid=c7c16d35-4d29-4097-84c8-0307d7fa83ef
© Pixel Trader Ltd. 2013 Alle Rechte vorbehalten
 Onlinemagazin – mit vielen Themen und Trends im Journal
Onlinemagazin – mit vielen Themen und Trends im Journal 
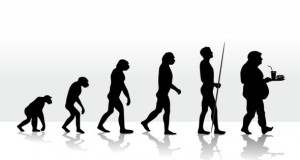


Aktien-Wissenschaft
Die erste Studie mit Mäusen wurde 2004 durchgeführt, jene mit Affen 7 Jahre später. Meine Frage in diesem Zusammenhang: Warum haben die Autoren sowie die Besitzer der Firma, die das Produkt herstellt, so lange mit der Durchführung der zweiten Studie gewartet? Wer steckt solch ein profitversprechendes ‘Wundermittel‘ freiwillig so lange in die Schublade!? Die Antwort ist einfach; der Autor hat es sogar selber erklärt: “the treated monkeys consumed less of their regular food” (siehe Artikel in Science 9.11.2011). Die Mäuse und Affen haben weniger gegessen (eine klassische Nebenwirkung) und aus diesem simplen Grund abgenommen! Die Gewichtsabnahme hat demnach mit dem Schrumpfen der Fettzellen gar nichts zu tun! Das erklärt auch, warum die Autoren so lange mit der zweiten Studie gewartet haben: Sie wussten (und wissen es immer noch), dass die Wirkung wissenschaftlich korrekt betrachtet/interpretiert eine Nebenwirkung ist! Aber… eine Studie mit Affen lässt die Aktien steigen! Das ist Pseudowissenschaft, die an Kriminalität grenzt!